Wenn die Medien schreiben, die Nationalbank pumpe wieder einmal Geld in die Märkte, dann meint fast die ganze Schweiz, unsere Zentralbank stelle den Banken Mittel zur Verfügung, die sie dann an die Wirtschaft ausleihen. Dass dieses Bild nicht stimmt, wissen wir spätestens seit dem letzten Blog-Artikel.
In Tat und Wahrheit schöpft nicht die Nationalbank Geld, sondern die privaten Banken. Bei jeder Kreditvergabe stellen Sie Geld her, das es vorher nicht gegeben hat. Das Beispiel aus der Broschüre «Die Nationalbank und das liebe Geld» (S. 18): Ein Sparer deponiert 20’000 Franken auf seinem Girokonto einer Bank. Davon verleiht diese 16’000 Franken an einen Unternehmer – der sich dafür eine Computeranlage kauft – und erhöht damit die Geldmenge um 16’000 Franken. Logisch: Der Sparer hat 20’000 Franken, echtes Geld, das er versteuern muss oder ausgeben kann. Und der Unternehmer hat 16’000 Franken, mit denen er Rechnungen bezahlen kann, also auch echtes Geld. Das ist die ganze Magie der Geldschöpfung.
Damit sich der Sparer keine Sorgen um sein Geld zu machen braucht, hält die Bank eine Mindestreserve zurück. In diesem Original-Rechenbeispiel der Nationalbank beträgt sie 20 Prozent. Das scheint sicher genug: Es kommen ja nicht alle Kontoinhaber gleichzeitig auf die Idee, ihr Geld auszugeben oder es in bar zu beziehen.
Wie hoch aber liegt der Mindestreservesatz tatsächlich? Die Frage kommt Werner Abegg, dem Kommunikationschef der Nationalbank, mit dem ich heute gesprochen habe, reichlich ungelegen. «Ich weiss es nicht so genau», sagt er zunächst. «Fragen Sie die FINMA, die legt die Sätze fest.» Ich insistiere. Der Mindestreservesatz sei einer der ganz zentralen Werte, mit dem die Geldschöpfung durch die privaten Banken beeinflusst werden könne. Das sei bestimmt Aufgabe der Nationalbank. «Ich bin ein bisschen überfragt», sagt Abegg, «wir haben im Moment dringendere Aufgaben.» Verständlich – die Frankenstärke! Da muss man täglich die Nationalbankpumpe neu anwerfen. Dann kommt nach einer kurzen Pause die Antwort: «Der Mindestreservesatz beträgt 2,5 Prozent», auf Giroguthaben, um genau zu sein.
Der tatsächliche Wert ändert das Rechenbeispiel der Nationalbank schlagartig: Von den 20’000 Franken des obigen Exempels kann die Bank nicht bloss 16’000 Franken verleihen, sondern 19’500. Und wenn der Lieferant der Computeranlage sein Geld auch zur Bank bringt und diese nach Rückbehalt von 2.5 Prozent wiederum 19’012.50 ausleiht, entstehen durch Wiederholung dieses Prozesses aus den ursprünglichen 20’000 Franken geschlagene 800’000.
Weil die Erfüllung des Mindestreservesatzes ein wichtiger Indikator für die Sicherheit des Geldes ist, publiziert die Nationalbank regelmässig die aktuellen Bestände. Wir können aufatmen: Gemäss den heute publizierten Daten beträgt der «Erfüllungsgrad» der Mindestreserven 330 Prozent. Anstatt 2.5 Prozent sind es also 8.25 Prozent. Das ist fast so gut wie im ausgehenden Mittelalter, als die italienischen Goldschmiede als Erfinder des modernen Bankwesens davon ausgingen, dass nie mehr als zehn Prozent der Gläubiger ihre Goldquittungen wieder in echtes Edelmetall zurücktauschen wollten.
Fazit: Die Nationalbank pumpt eigentlich fast nichts, 2,5 bis 10 Prozent vielleicht. Es sind die Banken, die pumpen. Und die pumpen erst, wenn wir sie Kredite sprechen können. Darf uns das erstaunen? Nein! «Jede Bank schöpft Geld», sagt Werner Abegg. «Das ist überall so.» Erschütternd, mit welcher Leichtigkeit ein leitender Angestellter einer staatsnahen Institution eine krasse Verfassungswidrigkeit zum Normalfall erklärt.
Aber vielleicht ist das Geld, das uns die Banken in die Konten schreiben (und Zins dafür verlangen), gar kein echtes Geld. Auszuschliessen ist in der Welt des verfassungswidrigen Geldes eigentlich nichts. Mehr zu dieser spannenden Frage morgen.
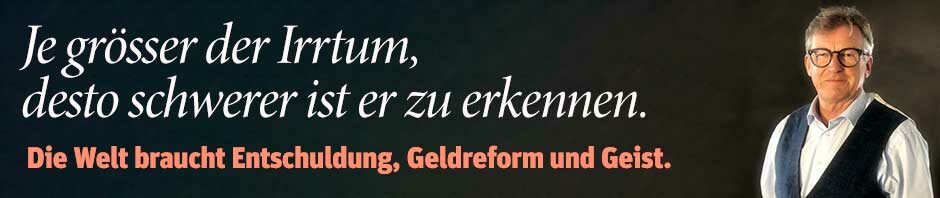

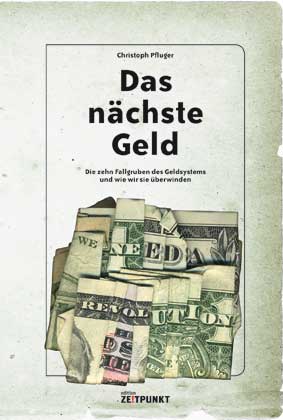

Sehr geehrter Herr Pfluger,
schon als junger Ingenieur lernte ich 1966/67 an der ETH bei Prof. Hans Würgler, wie die Geldschöpfung funktioniert – wir jungen Ingenieure konnten es kaum glauben.
40 Jahre später, als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachhochschule FHNW, machte ich anlässlich einer Kaffeepause eine Umfrage bei den Dozenten: Keiner wusste etwas von dieser Geldschöpfung durch das Geschäftsbankensystem.
Meine Erachtens – ich habe mich schon mit vielen Ideen, u. a. dem Schwundgeld herumgeschlagen – ist diese Geldschöpfung des Pudels Kern. Bestätigt hat dies einer der besten Geldtheoretiker der Schweiz, Prof. Hans Christoph Binswanger. In zwei Zeitungsartikeln (Basler Zeitung 7.11.2008 und bz 6.6.2009) forderte der die Einführung des 100%-Geldes, des „Vollgeldes“ (nur die Notenbank darf Geld schöpfen), um zukünftige Finanzblasen zu verhindern. Meines Erachtens ist die Geldschöpfung des privaten Bankensektors, zur Zeit sind über 90% des Geldes solche Gelder, eines der grössten Übel unseres (kapitalistischen) Systems. Einerseits ist es für die Banken ein riesiges Geschäft. Andererseits wird dadurch die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der Geldmenge durch die Nationalbank praktisch unmöglich, und damit befördert dieses System über die Inflation die Umverteilung des Volksvermögens von arm zu reich in einem nie dagewesenen Ausmass.
Leider hat keine politische Partei – auch von der linken Seite nicht – den Durchblick: Ich habe bei den Grünen, der SP und den Juso schon versucht, Aufklärung zu betreiben; eine Antwort habe ich nie bekommen. Deshalb haben unsere „blinden“ Volksvertreter/innen das neue Nationalbankgesetz mit dem Mindestreservesatz von 2,5 % – unter BR Villiger in die Wege geleitet – im Parlament einfach durchgewinkt. Früher war dieser Reservesatz wenigstens noch im Bereich von 20 %.
Eigentlich müsste man eine Volksinitiative starten – aber welcher Einzelkämpfer könnte dies? Somit müssen wir ohnmächtig zusehen, wie unsere Gesellschaft von den Mächtigen nach und nach in eine Zweiklassengesellschaft verwandelt wird. Damit sägen die Mächtigen und Superreichen am Ast, auf dem sie sitzen…
Mit freundlichem Gruss
W. Zumbrunn
Master of Science ETH
4132 Muttenz