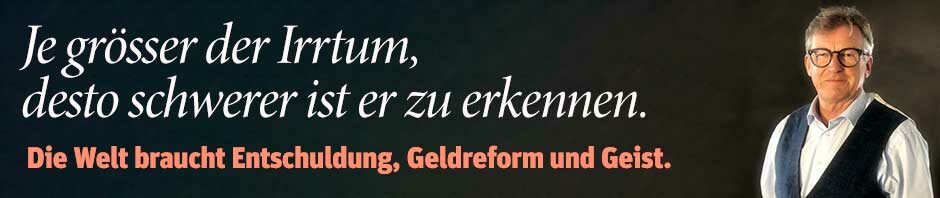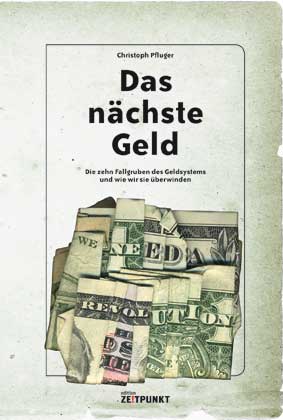Der gewerkschaftsnahe Thinktank «Denknetz» beehrt die Vollgeld-Reform in seinem jüngsten Jahrbuch (Inhalt, pdf) gleich mit zwei ausführlichen Kritiken. Die eine ist eine Auftragsarbeit des Finanzjournalisten Gian Trepp, die andere stammt von Beat Ringger, dem Chef des Denknetzes selber. Beide erklären den Zweck der Vollgeldreform, die Unterbindung der Geldschöpfung durch die privaten Banken korrekt.
Trepp lehnt sie ab, weil sie ihr Ziel, die Stärkung der Realwirtschaft, nicht erreiche und schlägt stattdessen «Trennbanken statt Vollgeld» vor. Es ist natürlich nicht verboten, die Vollgeld-Initiative an einem erwünschten Nebeneffekt zu messen – dem Nutzen für die Realwirtschaft –, aber dann bitte richtig. Rund drei Viertel der von den privaten Banken in den letzten Jahrzehnten geschöpften Gelder dienten nicht der Finanzierung von realwirtschaftlichen Projekten, sondern flossen in den Kapitalmarkt. Das viele Geld ermöglichte dort schöne Buchgewinne. Derweil geriet die weniger profitable Realwirtschaft unter Druck. Entlassungen, Auslagerungen in Billiglohnländer, Lohnsenkunen waren die Folge. Würde der Staat unter einem Vollgeldregime die Anleger bevorzugen, wie dies die Banken jetzt tun, wäre die Reform tatsächlich ein Schlag ins Wasser. Wird er aber nicht. Er wird vielleicht Schulden abbauen, dann können die Anleger selber schauen, wo sie ihr Geld am besten einsetzen (warum nicht in der Realwirtschaft?). Vor allem aber wird er sein neu geschöpftes Geld in Infrastruktur, Bildung und Beschäftigung investieren wollen. Dort werden sich die Gewerkschafter darüber freuen, dass ihre Vordenker ihre Meinung geändert und die Vollgeld-Initiative unterstützt haben werden.
Das Missverständnis von Beat Ringger liegt etwas tiefer. Seiner Ansicht nach muss «irgendwo auf der Welt jemand profitable Arbeit verrichten, damit Gewinne erzielt werden können.» Das stimmt nur unter zwei Bedingungen, die allerdings bei weitem nicht erfüllt sind: Erstens darf die Geldmenge nicht schneller wachsen als das Bruttosozialprodukt. Und, falls sie schneller wächst, müssten alle Gewinne in reale Werte umgewandelt werden. Aber dieser Moment ist noch nicht da, und wenn er kommt, wird es für einen realistischen Umtausch zu spät sein. Zur Zeit wandert das von den Banken geschöpfte neue Geld wie erwähnt überwiegend in die Finanzwirtschaft, wo es den Buchwert der Anlagen mehrt. Der Gewinn besteht aus aufgeblasenem Geld, der erst dann real wird, wenn es auch für reale Güter ausgegeben wird. Das wird zwar vermehrt getan, aber das meiste rast nach wie vor durch die riesige, globale Finanzblase.
Warum schöpfen die Banken mehr Geld, als die Realwirtschaft benötigt? In unserem Kreditgeldsystem liegen die Schulden (Amortisation und Zinsverpflichtungen) logischerweise immer höher als die vorhandene Geldmenge. Um die notwendigen Gelder schöpfen zu können, kreierten die Banken laufend neue, von der Realwirtschaft zunehmend abgekoppelte Papiere, die belehnt werden konnten und neue, zunehmend kreditunwürdige Schuldner. Das Problem liegt weniger in den spekulativen Investmentbanken, wie Trepp und Ringger behaupten, sondern in einem System der privaten Geldproduktion, das die Spekulation für sein Überleben zwingend braucht. Mit solchem Blasengeld lässt sich nicht wirtschaften, sondern nur spekulieren – natürlich nicht auf Dauer, wie wir in der Krise erkennen. Ihr Vorschlag, das Trennbankensystem einzuführen, nützt zwar etwas, aber er trennt nur die Verwalter des Blasengeldes von denen des realeren Geldes. Zudem konnte das Trennbankensystem, wie es in den USA bis 1999 galt, weder die zerstörerische Flut von Petrodollars in den 70ern, noch die Schuldenkrise der 80er und die Dotcom-Exzesse der 90er Jahre verhindern.
Und so «keimfrei» und «unbefleckt von sozialen Fragen», wie Beat Ringger schreibt, ist die Vollgeld-Reform auch wieder nicht. Immerhin greift sie mit der zinsbehafteten Kreditgeldschöpfung durch die privaten Banken einen fundamentalen Umverteilungsmechanismus in unserer Wirtschaft auf. Vom Zins profitieren nur die 15 Prozent Reichsten, alle anderen, namentlich alle Arbeitnehmer zahlen drauf. Die Vollgeld-Reform eliminiert zumindest den Zins auf der Stufe der Geldschöpfung und realisiert so einen Nutzen für die Allgemeinheit von rund 20 Mrd. Franken pro Jahr. Das ist der Geldschöpfungsgewinn, den bis jetzt die privaten Banken für sich einbehalten.
Es wäre zu begrüssen, wenn im Denknetz nicht nur unter seinesgleichen gedacht, sondern auch mit Andersdenkenden gesprochen würde. Ich halte mich für ein Gespräch bereit, gerne auch öffentlich. Zuerst kontrovers und dann einvernehmlich. Schliesslich arbeiten wir alle für das gleiche Ziel, eine gerechte Wirtschaft.
Denknetz Jahrbuch 2012 – auf der Suche nach Perspektiven. Verlag Edition8, 2012. 228 S. Fr. 25.–/€ 19.–. ISBN 978-3-85990-174-2