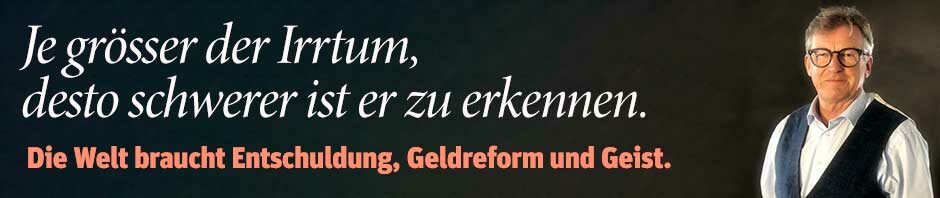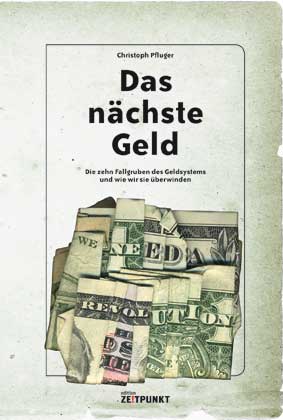Das war vermutlich die hochkarätigste Diskussionsrunde über Fragen des Geldsystems seit einem Jahr – und die Medien blieben fern. Gestern Donnerstag diskutierten an der ETH Zürich Vertreter der Bankiervereinigung und Avenir suisse mit den Ökonomie-Professoren Helmut Dietl (Uni Zürich), Sergio Rossi (Uni Freiburg) und Joseph Huber (em. Uni Halle) über die Frage «Sind Geld und Banken zukunftsfähig?». Anlass des Podiumsgesprächs unter der Leitung von Klaus Ammann (Radio SRF 1) war Joseph Hubers Konzept einer Vollgeld-Reform, zu der zur Zeit für eine Volksinitiative Unterschriften gesammelt werden.
Was ist die tiefere Ursache der Finanzkrise? Joseph Hubers Analyse in der Zusammenfassung: Weil die Geldmenge in den letzten Jahrzehnten rund viermal schneller gewachsen ist als das Bruttosozialprodukt, wanderte das Geld bevorzugt in die Finanzwirtschaft und erzeugte dort Blasen und andere Verwerfungen. Dabei handelt es sich nicht um Geld im rechtlichen Sinn, sondern nur um einen Anspruch darauf, den die Banken auf Wunsch erfüllen müssen – aber insgesamt nicht erfüllen können. Helmut Dietl bestätigte, dass die Banken mit ihrer eigenen Geldschöpfung «ein Versprechen abgeben, das sie nicht halten können». Und das sei ein wesentlich grösseres Problem, als wenn andere ihre Versprechen nicht einhielten. Besonders problematisch ist nach Ansicht von Sergio Rossi die Geldschöpfung der Banken deshalb, weil sie nicht immer mit Produktion gekoppelt sei, was zu einer Inflation bei Anlagegütern (Wertpapieren und Immobilien) führe.
Martin Hess, Chefökonom der Bankiervereinigung meinte, die Nationalbank könne die Geldschöpfung der Banken über den Zins ausreichend kontrollieren, blieb aber den konkreten Beweis schuldig. Man rechne also selber nach: Nehmen wir an, einer Bank fehle die für die Kreditvergabe von 1 Mio. Franken (=Geldschöpfung) erforderliche Mindestreserve von 25’000 Franken. Dann muss sie sich bei der Nationalbank gegen die Hinterlegung von Sicherheiten das nötige Zentralbankgeld ausleihen und dafür den Leitzins von aktuell 0.75 Prozent bezahlen, also 187,50 Franken. Will die Nationalbank die private Geldschöpfung durch die Banken erschweren, erhöht sie den Leitzins. Bei einer Verdoppelung – was in der Geschichte der SNB noch nie vorgekommen ist –, erhöhen sich die Kosten der Bank auf 375 Franken. Wird sie dadurch von dem Geschäft abgehalten, das ihr bei einem Jahreszins von 5 Prozent 50’000 Franken einbringt? Man entscheide selber.
Martin Hess erkannte aber richtig: «Wenn die Geldschöpfung frei wäre, wäre das wie ein perpetuum mobile und tatsächlich ein Problem.» Nur: Funktioniert die privatisierte Geldschöpfung mit ihrem Zwang zur Selbstvermehrung nicht tatsächlich wie ein perpetuum mobile?
Dieses Problem will die Vollgeld-Reform durch die Beschränkung der Geldschöpfung auf die Nationalbank beheben. Nur sie soll Geld in Umlauf bringen können, nach Massgabe des Wirtschaftswachstums und den Bedürfnissen der Realwirtschaft. Die Banken dürfen nur noch Geld verleihen, das sie tatsächlich haben und das ihnen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wird.
Die Kritik von Rudolf Walser des ThinkTanks avenir suisse konzentrierte sich auf den Umstand, dass die Vollgeld-Reform in den vielen offiziellen Berichten der internationalen Finanzorganisationen gar nicht erwähnte werde und es sich dabei um eine nicht erprobte Reform handle. Nach Ansicht von Martin Hess würde die Kreditversorgung massiv zurückgehen und das «Bankensystem implodieren». Die Professoren auf dem Podium waren sich allerdings weitgehend einig, dass die Realwirtschaft von einer solchen Reform profitieren und vor allem das Investmentbanking eingeschränkt würde. Dieses beschäftigt allerdings in der Schweiz nach Auskunft von Martin Hess weniger als 1000 Mitarbeiter und sorgt für weniger als zwei Prozent der Bankenerträge. Die Schrumpfung des Investmentbankings erscheint also erträglich.
Keine gute Figur machten die Vertreter der Bankiervereinigung und von avenir suisse mit der Behauptung, die Banken seien nicht nur Geldschöpfer, sondern auch Geldvermittler. Wir Joseph Huber unwidersprochen erklärte, handelt es sich beim Geld auf unseren Bankkonten um Verpflichtungen der Banken, die auf ihrer Passivseite verbucht würden. Mit diesen Schulden der Banken können vielleicht wir Bankkunden bezahlen, aber nicht die Banken selber. Daher gäbe es auch nichts zu vermitteln.
Fazit: Die Finanzkrise ist nicht nur ein Verhaltensproblem der betroffenen Akteure, wie Sergio Rossi unterstrich, sondern auch ein Strukturproblem. Solange sich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes dieses Landes nicht für diese Strukturen interessieren und sie zu verstehen lernen, wird die wichtige Debatte darüber unter dem selbstgewählten Ausschluss der Medien stattfinden und die nötige Reform mangels politischen Drucks erschwert. Damit sich dies ändert, hat die Organisatorin des Podiums, PD Dr. Irmi Seidl, Lehrbeauftragte Ökologische Ökonomik an der ETH Zürich einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Früchte reifen, aber geerntet wird später.
Die Teilnehme des Podiums (v.l.n.r.): Martin Hess, Chefökonom der schweiz. Baniervereinigung, Rudolf Walser (avenier suisse), Prof. Sergio Rossi (Uni Fribourg), Klaus Amman (Gesprächsleitung), Prof. Joseph Huber (em., Uni Halle), Prof. Helmut Dietl (Uni Zürich)
_________
Die nächste, von Irmi Seidl organisierte Veranstaltung zum Thema findet statt am Mittwoch, 27. Mai 2015,
Thomas Mayer, ehem. Chefvolkswirt der Deutschen Bank spricht über
Brauchen wir eine Geldreform?
19.00-20.30h, ETH Zentrum, Raum HG D 5.2
_________________________
Weiterführende Links: