Boris Johnson hat 42 Prozent seiner eigenen Fraktion gegen sich. Seine Tage als britischer Premier sind gezählt. Der wahre Grund – seine Politik der Eskalation – wird von den Medien allerdings nicht erwähnt.
Kriegsbegeisterung hält selten lange. Dass dies auch für einen Wirtschaftskrieg gilt, erfahren die europäischen Regierungen zur Zeit mit zunehmender Schärfe.
Boris Johnson überlebte am Montag die Misstrauensabstimmung seiner eigenen Fraktion mit einem «Sieg» von 211 zu 148 Stimmen. Mit anderen Worten: 42 Prozent seiner eigenen Leute haben kein Vertrauen mehr in eine Zukunft mit ihm! Teresa May hatte 2019, ebenfalls in einer Vertrauensabstimmung, nur 117 gegen sich – und musste ein paar Monate später trotzdem zurücktreten.
Als Gründe für Johnsons Niedergang werden an erster Stelle meist seine verbotenen Corona-Parties genannt. Aber wenn die Wirtschaft brummt und die Leute mehr Geld in der Tasche haben, werden exzessive Lebensfreuden gerne entschuldigt. Aber Grossbritannien steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren.
Beschleuniger und Hauptursache von Rezession und Inflation sind die Sanktionen, die Russland schädigen sollten, aber jetzt auf Europa zurückfallen, und auf Grossbritannien ganz besonders.
Es war Boris Johnson, der als erster Waffen lieferte und als erster von Selenskyj die Ablehnung von Verhandlungen forderte. Neben Polen war Grossbritannien der grösste Scharfmacher – als ob die Probleme im Donbass, die mit der Durchsetzung des Minsker Abkommens hätten gelöst werden können, die Sicherheit der Briten tangierten und einen grösseren Krieg wert seien.
Johnson ist nicht der erste Politiker, der die Quittung für seine Kriegsbegeisterung erhält. In Estland ist ein paar Tage früher die Regierungskoalition zerbrochen, wegen der «Sicherheitslage in Europa», wie Ministerpräsidentin Kaja Kallas sagte. Kallas – «die härteste Frau Europas» (Watson) – setzte sich lautstark für schärfere Sanktionen gegen Russland und sogar für militärische Aktionen der NATO ein. Estland hat als erstes EU-Mitglied zusammen mit Lettland und Litauen ein totales Embargo auf russisches Öl beschlossen.
Eine Stimmenthaltung – der parteilosen iranisch-stämmigen Kurdin Amineh Kakabaveh – rettete am Dienstag die schwedische Regierung vor dem Rücktritt. Die Vertrauensabstimmung war von den «Schwedendemokraten» beantragt worden, die der Regierung unter der Sozialdemokratin Magdalena Andersson vorwarfen, zu wenig gegen die Bandenkriminalität zu tun.
Trotz des innenpolitischen Konflikts lag die Geopolitik schwer über dem schwedischen Parlament. Kakabaveh spielt eine wichtige Rolle bei der Weigerung Erdogans, Schweden als Mitglied in die NATO aufzunehmen, solange das Land kurdische «Terrororganisationen» unterstütze.
Das Öl-Embargo wird die EU weiter destabilisieren. Vor kurzem beschlossen, wird es von Ungarn bereits wieder in Frage gestellt. Zudem gilt es nur für Öl, das mit Tankern geliefert wird, da einige Binnenländer praktisch komplett vom russischen Pipeline-Öl abhängig sind. Einige EU-Staaten werden billiges Öl aus Russland haben, andere teureres aus entferteren Quellen.
Aber es gibt auch technische Probleme bei der Raffinierung: Rohöl gibt es in Hunderten von Sorten. Aber nur die russischen «Urals» haben die optimale Zusammensetzung für den in Europa populären Diesel. Damit Mischungen von schwereren und leichteren Sorten verarbeitet werden können, müssen die Raffinerien kostspielig und zeitaufwändig umgerüstet werden. Zudem sind die Lieferketten in Handel und Verarbeitung von Rohöl derart durchoptimiert, dass kleinere technische Änderungen grössere Disruptionen verursachen können.
Dazu kommt, dass das «Embargo extra-light» (FAZ) erst 2023 voll greift. Bis dahin profitiert Russland von steigenden Preisen, die von den europäischen Konsumenten bezahlt werden müssen – ein doppelter Misserfolg, mit dem kein Wahlkampf zu gewinnen ist.
Wohl nicht ohne Grund sprach der türkische Premier Erdogan am Sonntag an einem Treffen seiner Partei von einer «Panik», die in Europa wegen des Kriegs in der Ukraine zu beobachten sei. Für einigermassen erfolgreiche Verhandlungen mit Russland ist die Position der EU zu schwach. Und sie wird schwächer, je weiter der seit Monaten propagierte baldige Sieg der Ukraine in die Ferne rückt.
Auf maximal zwei Monate befristete Kissigner am WEF in Davos das Fenster für Verhandlungen. Das scheint angesichts seines hohen Alters etwas gar gemütlich.
Vermutlich werden vorausschauende Politiker in verschiedenen europäischen Ländern bereits jetzt im Kreml nach gangbaren Wegen nach dem Krieg suchen. Es dürften die Leute sein, welche die Johnsons von heute ablösen werden.
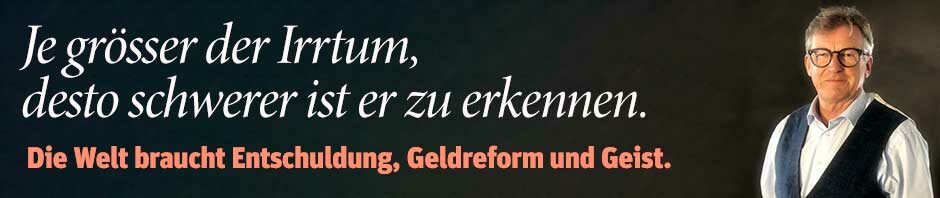

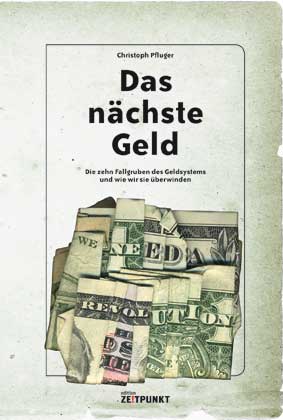

Lieber Christoph Pfluger,
Das sind kleine Strahlen der Hoffnung auf bessere Zeiten! Es hat immer mehr den Anschein, als hätten manche Länder/ Politiker das Rad der Zumutungen an die Demokratie und ihre Bevölkerungen allmählich überdreht. Gleichzeitig bellen und schlagen diese Leute desto heftiger um sich, je offensichtlicher ihnen die Argumente ausgehen und ihr Handeln realitätsfremd wird. Dabei ist der unselige Krieg in der Ukraine ja längst nicht das einzige Feld, wo sich ein Versagen und eine Provokation an die andere reiht.
Die Amerikaner wollen demnächst zum wiederholten Male im deutschen Ramstein grossen Kriegsrat halten. Das deutet vielleicht auf Verunsicherung, aber nicht auf Entspannung hin.
Erdogan, so löblich sein Ausscheren bezüglich der Sanktionen sein mag (und diese Tatsache macht das gegenteilige Verhalten der Schweizer Politik noch schandbarer), hat, wie man weiss, erhebliche innenpolitische Probleme, nach der Zinserhöhung explodieren dort die Preise, selbst im Verhältnis zur Inflation im übrigen Europa.
Der Krieg schreibt seine eigenen Gesetze, das lehrt uns die Geschichte, und diese sind weit schwerer zu durchschauen als die einer friedlich andauernden Ordnung. Das gilt auch für den Krieg der Staaten gegen die Bevölkerungen, der sich Pandemie nennt.
Kommt hinzu, dass es sehr schwierig geworden ist, an unzensierte und unmanipulierte Fakten überhaupt noch heranzukommen, und es wird immer noch schwieriger. Ebenso sind Prognosen jeder Art erschwert durch die Tatsache, dass sich seit zwei Jahren die Ereignisse überschlagen und man vor keiner Überraschung mehr sicher sein kann, d.h. die Voraussetzungen für eine Beurteilung der Lage ändern sich rasend schnell, so wie diese Lage selbst.
Dennoch scheint es mir weit wichtiger, nach Anzeichen zu suchen, die Anlass zu Hoffnung geben und uns helfen, den Mut nicht sinken zu lassen, als einem allzu wohlfeilen Defaitismus nachzugeben.
Diese Haltung scheinen Sie mir vorbildlich zu verkörpern.